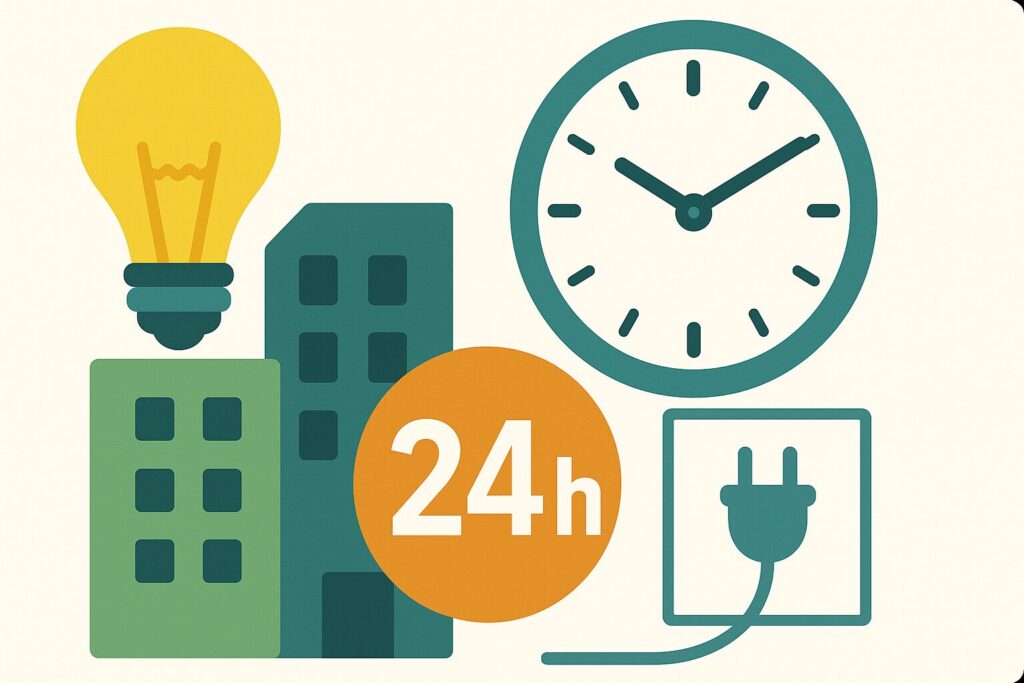A
AC-Laden
Das Laden mit Wechselstrom wird auch als AC-Laden bezeichnet. Öffentliche Ladesäulen stellen meistens eine Ladeleistung von bis zu 22 kW bereit.
Ampere
Basiseinheit für die Stärke des elektrischen Stroms – benannt nach dem französischen Physiker und Mathematiker Marie André Ampère.
Arbeit
Der „verbrauchte“ Strom wird als elektrische Arbeit bezeichnet. Die Arbeit wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen.
Arbeitspreis
Der Arbeitspreis ist das Entgelt für die verbrauchte Strommenge. Er gibt an, wie viel jede verbrauchte Kilowattstunde (kWh) Strom kostet.
AVBWasserV
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)
B
Blockheizkraftwerk (BHKW)
Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist eine modular aufgebaute Anlage zur Gewinnung elektrischer Energie und Wärme, die vorzugsweise am Ort des Wärmeverbrauchs betrieben wird. Es kann auch Nutzwärme in ein Nahwärmenetz eingespeist werden. Sie nutzt dafür das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung.
Bundesnetzagentur
Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen ist eine Bundesbehörde, die u.a. über den fairen Wettbewerb am Energiemarkt wacht.
www.bundesnetzagentur.de
D
DC-Laden
Das Laden mit Gleichstrom wird auch als DC-Laden bezeichnet. Die Schellladestationen können bis zu 300 kw bereitstellen.
Drehstrom
Drehstrom ist die allgemein übliche Bezeichnung für Drei-Phasen-Strom bzw. dreiphasigen Wechselstrom mit einer Spannung von 400V. Die öffentliche Versorgung mit Energie erfolgt durch Drehstrom (Dreiphasenwechselstrom).
E
E-Mobilität / Elektromobilität
Elektromobilität beschreibt die Beförderung von Personen und Gütern mithilfe elektrischer Antriebe. E-Autos fahren in der Regel mit elektrischem Gleichstrom (DC). Es gibt sowohl Wechselstromladestaionen (AC) als auch Gleichstromladestationen (DC), die mit bis zu 300 kW Ladeleistungendeutlich eine deutlich schneller Ladung ermöglichen.
Energiebeschaffung
Zur Reduktion des Beschaffungsrisikos wird Energie zu verschiedenen Zeitpunkten in Teilmengen beschafft. Am häufigsten werden Tranchenmodelle und Portfoliomanagement zur Energiebeschaffung eingesetzt. Der Energieeinkauf ist ein Bestandteil der Energiebeschaffung.
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
Erdgas
Brennbares Gas aus unterirdischen Lagerstätten
Erneuerbare Energien
Erneuerbare bzw. regenerative Energien sind Energiequellen, die nach den Zeitmaßstäben des Menschen unendlich lange zur Verfügung stehen. Zu den erneuerbaren Energien zählen Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Erdwärme.
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
Es soll im Interesse des Klima-, Natur- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte verringern, Natur und Umwelt schützen, einen Beitrag zur Vermeidung von Konflikten um fossile Energieressourcen (Erdöl, Erdgas, Kohle) leisten und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern.
G
Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV)
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz.
K
KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau
Mit ihren Förderprogrammen im Bereich "Bauen, Wohnen, Energie sparen" verhilft die KfW Bankengruppe immer mehr Menschen zu Wohneigentum und finanziert die Modernisierung von Wohnraum. Dabei spielt der Schutz von Umwelt und Klima eine wichtige Rolle. www.kfw.de
KfW-Energiesparhaus 40
Der Standard eines KfW-Energiesparhauses 40 ist erreicht, wenn der jährliche Primärenergiebedarf nicht mehr als 40 kWh pro m2 Gebäudenutzfläche beträgt.
Diesen Standard kann man mit einer sehr großen Solaranlage und sehr guter Wärmedämmung erreichen. Alternativ kann auch ganz auf eine konventionelle Heizung verzichtet werden. (vgl. auch Passivhaus)
KfW-Energiesparhaus 60
Der Standard eines KfW-Energiesparhauses 60 ist erreicht, wenn der jährliche Primärenergiebedarf nicht mehr als 60 kWh pro m2 Gebäudenutzfläche beträgt. Hier ist eine herkömmliche Heizungsanlage möglich, eine Lüftungsanlage ist in der Regel nicht erforderlich.
Kilovolt
1.000 Volt
Kilowatt
1.000 Watt
Kohlenstoffdioxid, CO2
Kohlenstoffdioxid ist ein farbloses, geruchsneutrales Gas aus Sauerstoff und Kohlenstoff. Umgangssprachlich wird CO2 oft als Kohlendioxid bezeichnet. Kohlenstoffdioxid ist ein Endprodukt beim Verbrennungsprozess.
Konzessionsabgabe
Finanzielle Gegenleistung von Energieversorgungsunternehmen an Städte und Gemeinden für das Recht, Straßen und Wege zu benutzen, um Kabel, Leitungen und andere Anlagen zu errichten, die zur Versorgung des Gebietes notwendig sind.
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
Die Konzessionsabgabenverordnung regelt die Zulässigkeit und Bemessung der Zahlung der Konzessionsabgabe an die Kommunen.
Kraft-Wärme-Kopplung
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bzw. Wärme-Kraft-Kopplung (WKK) ist die gleichzeitige Gewinnung von mechanischer Energie, die in der Regel unmittelbar in elektrischen Strom umgewandelt wird, und nutzbarer Wärme in einem gemeinsamen thermodynamischen Prozess, üblicherweise in einem Heizkraftwerk.
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung
L
LED
LED ist die Abkürzung von "Licht emittierende Diode" bzw. "light emitting diode". Bei LEDs handelt es sich um elektronische Halbleiterelemente. Die modernsten LED-Lampen bringen gegenüber Stromsparlampen nochmals eine leichte Steigerung der Effizienz. Zusätzlich haben sie die Vorteile, dass sie gegenüber Stromsparlampen kaum elektromagnetische Emissionen erzeugen und in der Entsorgung unproblematisch sind, da sie kein Quecksilber enthalten.
M
Mehr- und Mindermengen
Die Mehr-/Mindermengen gemäß § 13 Abs. 3 Strom-NZV ergeben sich aus der Differenz zwischen der auf Basis einer Prognose vom Lieferanten bereitgestellten, und der vom Kunden tatsächlich bezogenen Energie. Eine Mehrmenge führt zu einer Vergütung, eine Mindermenge zu einer Nachverrechnung an den Lieferanten.
N
Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck.
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung.
P
Passivhaus
Beim Passivhaus beträgt der maximale jährliche Heizwärmebedarf höchstens 15 kWh pro m2 Wohnfläche.
Zum Heizen dieses Gebäudes sind Wärmerückgewinnung durch ein Lüftungssystem, eingestrahlte Sonnenenergie sowie die Eigenwärme der Personen und elektrischen Geräte im Haus ausreichend.
R
Regel- und Ausgleichsenergie
Die Regelenergie gleicht den Stromfluss in einer Regelzone aus, die Ausgleichsenergie den Geldfluss in Bilanzkreisen, also das bilanzielle Gleichgewicht des virtuellen Energiemengenkontos.
Regulierungsbehörde
Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen ist eine Bundesbehörde, die u.a. über den fairen Wettbewerb am Energiemarkt wacht. www.bundesnetzagentur.de
RLM – Registrierende Leistungsmessung
Die registrierende Leistungsmessung (RLM), auch registrierende Lastgangsmessung, beschreibt eine zeitlich präzise Messung der Entnahme von Strom oder Gas aus dem Netz. Die Messung wird viertelstündlich (Strom) bzw. stündlich (Gas) durch einen Messstellenbetreiber vorgenommen.
S
SLP – Standardlastprofil
Ein Standardlastprofil (SLP) ist ein repräsentatives Lastprofil, welches den typischen Verlauf der abgenommenen elektrischen Leistung abbildet. Es dient dazu, den tatsächlichen Lastgang an einer Stelle im Netz (Marktlokation) ohne registrierende Leistungsmessung zu prognostizieren und zu bilanzieren.
Standby-Verlust
(Reduzierter) Energieverbrauch von technischen Anlagen und Geräten im Bereitschaftsbetrieb.
Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV)
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz.
V
Volt
Elektrische Spannung (vgl. auch Kilovolt)
W
Wasserkraft
Natürliche Energie, die mit Hilfe von Wasserrädern oder Wasserturbinen aus fließendem Wasser gewonnen wird.
Watt
Maßeinheit für Energie, benannt nach dem schottischen Erfinder James Watt (vgl. auch Kilowatt)
Windenergie
wird aus Windkraftanlagen gewonnen, die durch die Nutzung der natürlichen Kraft elektrische Energie erzeugen.